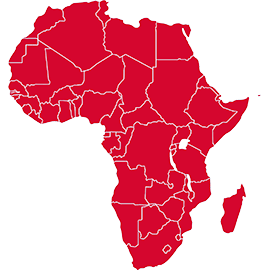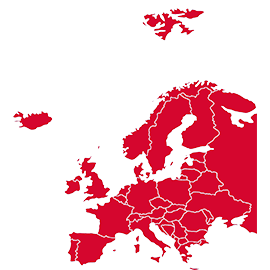Ab Ende 2023 müssen alle neuen mobilen Maschinen und Geräte (NRMM - non-road mobile machinery) in Europa die neuen Emissionsvorschriften der Euro Stufe V erfüllen.
Diese Vorschriften, die sowohl für Diesel- als auch für Flüssiggasstapler gelten, gelten als die strengsten Emissionsnormen der Welt und sollen die Luftqualität verbessern, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Die Stufe-V-Verordnung verschärft die Emissionsgrenzwerte für Feinstaub (PM), insbesondere für Stickoxide (NOx) und Kohlenmonoxid (CO).
Konkret müssen ab 2021 alle neu hergestellten Maschinen die Normen der Stufe V erfüllen. Dies betrifft Maschinen zwischen 56 und 130 kW sowie Maschinen unter 37 kW. Diese Maschinen dürfen unabhängig vom Hubraum nicht mehr als 0,015 g/kW Ruß ausstoßen. Das ist eine Reduzierung um 40% gegenüber Stufe IV, wo der Emissionsgrenzwert bei 0,025 g/kW lag.
Die Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Motoren die Anforderungen der Stufe V erfüllen, indem sie an jedem Motor eine Emissionskennzeichnung anbringen, die durch die Motorabdeckung sichtbar ist. Diese Kennzeichnung muss den Namen, die Handelsmarke des Herstellers, die Bezeichnung der Motorfamilie, das Herstellungsdatum und die Seriennummer enthalten. Motoren ohne diese Kennzeichnung entsprechen nicht den Vorschriften.
Partikelemissionen sind für LPG-Fahrzeuge kein Problem, aber zur Beseitigung der Stickoxide ist ein Katalysator erforderlich. Dies hat die größten Auswirkungen auf den Markt für Dieselstapler, wo die Hauptlösung zur Erfüllung dieser Anforderungen der Dieselpartikelfilter war.
Dieselpartikelfilter werden eingesetzt, um den Ausstoß von Ruß zu verhindern, wenn ein Fahrzeugmotor so umgerüstet wird, dass er weniger Stickoxide ausstößt. Bei dieser Umrüstung wird die Verbrennungstemperatur durch die Kühlung der Abgase gesenkt, was einen Dieselpartikelfilter erforderlich macht, um den daraus resultierenden Rußausstoß zu verhindern.
Gabelstapler mit Dieselpartikelfilter müssen in der Regel regelmäßig gereinigt werden, in der Regel ein- bis zweimal pro Woche. Dabei wird der Motor 20 bis 30 Minuten laufen gelassen, um den Ruß zu verbrennen. Dies hat für viele Fahrzeuge den Nachteil, dass sie viel Kraftstoff verbrauchen, längere Standzeiten haben und ihre Produktivität sinkt.